Die Homepage von Joachim Mohr
Stimmungen in der 53-Skala
Ich verwende hier die 53-Skala nach Mercator mit K=1200/53 Cent. Bei ihr beträgt in reiner Stimmung der große Ganzton 9K, der kleine Ganzton 8K und der diatonische Halbton 5K. Sie ist anschaulich und weicht von den exakten Werten in Cent maximal 2 Cent ab.pythagoreische Stimmung
Pythagoreische Stimmung nach Boethius (um 480-525 n.Chr., „De musica libri quinque“)
Nach der Quintenfolge b-f-c-g-d-a-e-h.Zu der ursprünglich 7-stufigen diatonischen Tonleiter kam noch ein 8. Ton hinzu. In aufsteigender Bewegung wurde der 7. Ton als h höher intoniert, in absteigender Bewegung als b tiefer.
44
b
0 9 18 22 31 40 50 53
c d e f g a h c
Im 13. und frühen 14. Jahrhundert wurden die bislang fehlenden chromatischen Halbtöne nach und nach
eingeführt, um den sich aus der damaligen Tonsatzlehre ergebenden Regeln zur Anwendung von „musica
ficta“ (also Akzidenzien) entsprechen zu können.
Pythagoreische Stimmung (nach Robertsbridge Codex um 1320)
5 13 27 36 44
cis es fis gis b
0 9 18 22 31 40 50 53
c d e f g a h c
Pythagoreische Stimmung (nach Anselmi/Arnaut/Keck/Galliculus)
4 13 26 35 44
des es ges as b
0 9 18 22 31 40 50 53
c d e f g a h c
mitteltönige Stimmung
In der Musikpraxis des 15. Jahrhunderts wurden die Terzen als Konsonanzen betrachtet und erklangen im späten 15. Jahrhundert sogar gelegentlich als Schlußakkord.
Es handelt sich hierbei nicht um die pythagoreische Terz. Diese klingt rau und wurde als Dissonanz betrachtet. Nun verwendete man die reine Terz (Frequenzverhältnis 5:4).
Beispiel:
Pythagoreische Terz c-e (klingt rau)
Reine Terz
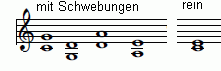
Frühe Beschreibungen der Mitteltönigen Stimmung findet man bei Pietro Aron (Toscanello 1523), Giuseppe Zarlino (Istitutioni harmonche 1573) und Michael Praetorius (Syntagma musicum 1619).
3¼ 13¾ 25½ 34 44½
cis es fis gis b
0 8½ 17 22¼ 30¾ 39¼ 47¾ 53
c d e f g a h c
Man sieht hier: Der gemittelte Ganzton hat 8 1/2 Teile, der diatonische Halbton 5 1/4 Teile, der chromatische Halbton 3 1/4 Teile und der Unterschied der harmonisch verwechselten Töne cis-des, dis-es,fis-ges,gis-as,ais-b beträgt 2 Teile.
Bei dieser Stimmung sind alle Dur-Dreiklänge rein ... bis auf h-dis-fis, fis-ais-cis, und des-f-as. Die Molldreiklänge sind alle rein ... bis auf as-ces-es, es-ges-b, b-des-f und f-as-c . In der Praxis wurden diese "Wolfs-"dreiklänge im 16. und frühen 17. Jahrhundert nicht benötigt. Mögliche Finaltöne waren nur f, c, g, d, a und e. Trotzdem gab es zwei Hauptprobleme:
1. Der H-Dur-Dreiklang wurde benötigt für den Finalakkord e-gis-h.
2. Orgeln waren im Chorton einen Ganzton höher als Instrumente gestimmt. Aber Transponieren für den Generalbas war nicht möglich.
Man erweiterte die Tastatur um des, dis, ges, as und ais:
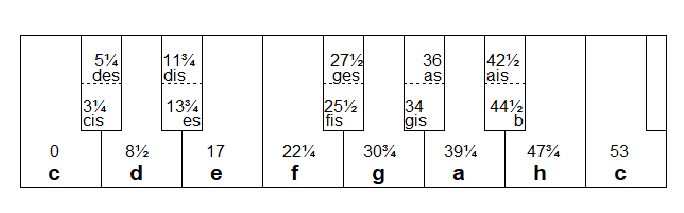
Dies war aber teuer und stimmtechnisch kompliziert.
Wohtemperierte Stimmungen
Nun modifizierte man die mitteltönige Stimmung so, dass man alle Akkorde spielen konnte, aber doch so, dass die C-Dur-nahen Akkorde reiner klangen.Rekonstruierte Stimmung von Christian Vater in Bockhorn von 1722
.
4 13 26 34¾ 44
cis/des dis/es fis/ges gis/as ais/b
0 8½ 17¼ 22 30¾ 39¼ 48¼ 53
c d e f g a h c
Stimmung von Gottfried Silbermann nach G. A. Sorge 1748
3¾ 13½ 26 34 5/8 44¼
cis/des dis/es fis/ges gis/as ais/b
0 8¾ 17¼ 22½ 30¾ 39½ 48 53
c d e f g a h c
